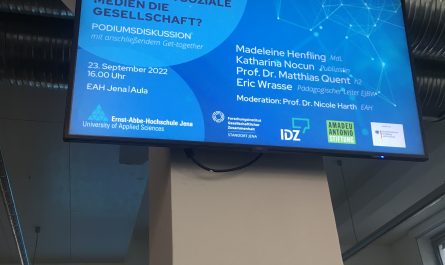Die aktuell massiv gestiegene Gefährdung von Jugendlichen durch die Anziehungskraft extrem rechter Netzwerke und Gruppen rückt erst jetzt ins Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit: Vermehrt treten Jugendliche als eigenständig agierende Mitglieder gewaltbereiter und gewalttätiger extrem rechter Gruppen in Erscheinung. Peer Wiechmann, Geschäftsführer des Distanz e.V. Weimar, spricht im Interview mit der RUK-Redaktion zur Distanzierungsarbeit mit rechtsextrem einstiegsgefährdeten bzw. orientierten Jugendlichen – ein Beitrag von Miriam Müller-Rensch
[Anm. der Redaktion: In der Erstfassung wurde dieses Interview geführt von Alina Oftadeh und Svenja Lotsch.]
Seit der Wiedervereinigung warnen Fachkräfte und Forschende in Deutschland vor der Anziehungskraft extrem rechter Netzwerke und Gruppen auf Jugendliche und junge Erwachsene.[i] Das akute Ausmaß der zunehmenden extrem rechten Orientierung junger Menschen wird nun verstärkt seit der Corona-Pandemie thematisiert. Zum deutschen Präventionstag 2024 spricht Sanem Kleff, Direktorin der Bundeskoordination Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, gar vom „größte[n] Rechtsruck unter Jugendlichen und Jungwähler*innen seit 1949.“[ii]
| Info-Box: Extremismus Grundsätzlich operiert „Extremismus“ als „Abgrenzungsbegriff“ der „nicht allein für sich, sondern [stets] in Abhängigkeit von einem anderen Begriff oder Wert definiert werden muss,“ so Pfahl-Traughber (2008, S.10). In der pluralen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland meine „Extremismus“ im Sinne einer „Negativ-Definition“ auch immer regelmäßig die „Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates“ (Pfahl-Traughber 2008, S.13f).Mehr Infos zu den Begriffen Rechtsextremismus und extreme Rechte. |
Die aktuell massiv gestiegene Gefährdung rückt jedoch erst jetzt ins Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit: Vermehrt treten Jugendliche als eigenständig agierende Mitglieder gewaltbereiter und gewalttätiger extrem rechter Gruppen in Erscheinung.[iii] Somit stellen sie als potenzielle Gewalttäter eine akute Gefahr für unsere Gesellschaft dar. Dennoch sind Jugendliche und junge Erwachsene ebenso Betroffene extrem rechter Einflussnahme und Manipulation und verdienen als Minderjährige unseren besonderen Schutz und Unterstützung. Wir alle – und insbesondere auch die sozialen Berufe – dürfen nichts unversucht lassen, sie für unsere demokratische Gesellschaft zurückzugewinnen.
Peer Wiechmann, Geschäftsführer des Distanz e.V. Weimar, arbeitet seit vielen Jahren in diesem komplexen Spannungsfeld.
Nach seiner Tätigkeit für das Archiv der Jugendkulturen in Berlin wurde Wiechmann Landeskoordinator für „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage.“ Im Anschluss leitete er die CIVITAS-Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus bei Radio LOTTE WEIMAR und bis 2019 den von ihm mitgegründeten Verein Cultures Interactive e.V. als Geschäftsführer. In der Präventionsarbeit prägte Wiechmann in Praxis und Theorie die jugendkulturellen lebensweltorientierten Ansätze in der direkten Arbeit mit rechtsextrem einstiegsgefährdeten und orientierten Jugendlichen in Deutschland.
RUK: Seit vielen Jahren arbeiten Sie vor allem mit rechtsextrem einstiegsgefährdeten Jugendlichen. Heute sind Sie Geschäftsführer eines Vereins, der sich ausschließlich auf Jugendliche und junge Erwachsene konzentriert: Wie genau arbeitet Distanz e.V.?
PW: Distanz e.V., das liegt schon im Namen des gemeinnützigen Vereins, macht ausschließlich Distanzierungsarbeit. Eine Distanzierungsarbeit, die aufsuchend passiert. Aufsuchend im Gemeinwesen. Und in Bezug auf die primäre Zielgruppe von Distanz e.V., der rechtsextrem einstiegsgefährdeten und orientierten Jugendlichen, bieten wir vornehmlich Distanzierungstrainings an, in der Gruppe und mit Einzelpersonen. Vielleicht kann man noch sagen, dass Distanz e.V. wahrscheinlich der erste Verein bundesweit, wahrscheinlich sogar europaweit ist, der sich ausschließlich der Distanzierungsarbeit im sogenannten Phänomenbereich Rechtsextremismus zuwendet – ohne Verbindung zur Ausstiegsarbeit. Da ist die Förderung in Thüringen aus meiner Sicht sehr progressiv und betrachtet die Zielgruppen differenziert.
RUK: Jugendliche sind eine besonders vulnerable Zielgruppe. Wie gelingt Ihnen der Zugang? Nutzen Sie Kooperationen, Netzwerke oder bestimmte Räume?

PW: Hier gibt es verschiedene Ebenen. Zunächst arbeiten wir mit dem „aufsuchenden Ansatz“: Auch in der Distanzierungsarbeit nutzen wir lebensweltorientierte Angebote, „Teaser-Workshops“ im Bereich der Medien- und Jugendkultur, aber auch politisch-historische Bildung als Zugänge zu den jungen Menschen und sogenannte sinnstiftende Alternativen für rechtsextrem einstiegsgefährdete und orientierte Jugendliche. Mit denen gehen wir direkt an Schulen, Jugendclubs, aber auch stationäre Einrichtungen, machen dort Workshops und Schulprojekttage. Vor Ort sprechen wir rechtsextrem einstiegsgefährdete und orientierte Jugendliche an und kommen so in Kontakt.
Häufiger läuft der Zugang aber über Multiplikator*innen und Verweisstrukturen. So sind es zum Beispiel die Jugendämter, die uns Jugendliche vermitteln, die auffällig werden, weil sie extrem rechte Codes oder starke Vorurteile äußern. Das passiert entweder über das Jugendamt und über sogenannte Diversionsverfahren, also wenn Justiz und Jugendamt solch ein Training als „letzte Chance“ anbieten, bevor eine Verurteilung stattfindet. Ein weiterer wichtiger Zugang ist die Schulsozialarbeit, mit der wir eng zusammenarbeiten. Und schließlich auch direkte Verweise über Polizei und Sicherheitsbehörden, die auffällige Jugendliche aufgreifen und ihnen oder den Eltern dann raten, ein Training bei uns zu machen.
| Info-Box: Aufsuchende Jugendarbeit und aufsuchende Sozialarbeit „Aufsuchende Soziale Arbeit und Jugendarbeit“ beschreibt sowohl eine professionelle Arbeitsmethode als auch spezifische Felder sozialer Arbeit, die sich in den letzten beiden Jahrzehnten stetig weiterentwickelten. Das zentrale Konzept der aufsuchenden Arbeit ist die Lebensweltorientierung (Müller/Bräutigam, 2024). Sie verortet die Umsetzungspraxis sozialer Arbeit und Jugendarbeit in den von jungen Menschen selbst genutzten und gestalteten sozialen Räumen. Ziel ist es, im persönlichen Gespräch und gemeinsamen sozialen Erleben, eine vertrauensvolle Beziehung zu jungen Menschen aufzubauen und diese auf Grundlage der Vertrauensbeziehung zu unterstützen und zu begleiten. Als Methode ist der „aufsuchende Ansatz“ auf überzeugende Weise anschlussfähig an die Arbeit in der politischen Bildung, Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention (AGJ, 2017), da es in der aufsuchenden Arbeit regelmäßig gelingt, die Ich-Identität von Jugendlichen zu stärken und gemeinsam positive Perspektiven zu entwickeln. Gleichzeitig kann es gelingen, gemeinsam mit den Jugendlichen für diese neue Fähigkeiten zu entwickelt, Bedürfnisse auszudrücken und soziale Konflikte zu formulieren und aufzulösen. |
RUK: Sie orientieren sich also an der aufsuchenden Jugendarbeit. Wie integrieren Sie dies in das Feld der Distanzierungsarbeit?

PW: Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit setzen wir den selbst konzeptualisierten „BRAKE“-Ansatz um. Bei uns, und das ist vielleicht aktuell noch zumeist der Unterschied zur Ausstiegsarbeit, haben wir es eigentlich nie mit intrinsischer Motivation der Teilnehmenden zu tun. Die sagen also nicht: „Ich will aussteigen!“ oder: „Ich will mich distanzieren.“ Unsere Klient*innen haben meist auch gar keine übergeordnete Struktur aus der sie aussteigen könnten. Was wir formulieren, ist ein Angebot, so dass die Jugendlichen im Idealfall gar nicht auf die Idee kommen, destruktive Kontaktangebote zu suchen oder anzunehmen. Wir gehen dafür aufsuchend in die Schulen oder in Jugendclubs. Wir sensibilisieren entsprechend Personal in Jugendämtern, in Schulen, der freien Jugendhilfe und der offenen Jugendarbeit.
Nicht selten erkennen Multiplikator*innen überhaupt erst dann, wenn sie sich fortbilden und bspw. Interventionstechniken zum Umgang mit der Zielgruppe erlernen, dass es sich um einstiegsgefährdete Jugendliche handelt. Dann vermitteln sie diese Zielgruppe an uns. Und das ist, so glaube ich, zumindest der wesentliche Unterschied zur „klassischen“ Ausstiegsarbeit: Dass wir intrinsische Motivationen erstmal in Vorgesprächen – vor unseren Trainings – gemeinsam mit den Klient*innen entwickeln müssen. Sonst fangen wir gar nicht erst mit einem Training an. Das ist wohl einer der Gründe, warum wir eine so geringe Abbruchquote in den Trainings selbst haben.
RUK: Und was genau umfasst der BRAKE-Ansatz?
 PW: Zunächst einmal bedeutet „BRAKE“ für uns eben nicht „brechen“, vielmehr ist es für uns die „Bremse“ von Radikalisierungsprozessen. Es ist natürlich ein Akronym, das sich als Bild angeboten hat. „BRAKE“ beinhaltet alles, was unseren Ansatz ausmacht: Wichtig ist das „B“, das steht für beziehungsgestützt. Wir gehen in diesen Trainings mit den Beteiligten eine Beziehung ein, um überhaupt eine nachhaltige Interventionsberechtigung zu erlangen. Das „R“ steht für Reflexionsarbeit, die wir in den Trainings mit den Klient*innen umsetzen: Die Jugendlichen sollen durchaus ihre Biografie, ihre Taten und Einstellungen reflektieren bzw. diese werden gemeinsam reflektiert. Das „A“ steht für aufsuchend. Einer der wichtigsten Aspekte von Beziehungsarbeit ist schließlich auf dieser Grundlage entsprechend kritisch zu sein und dass diese Kritik („K“) über eine bestehende Beziehung vom Gegenüber auch wirklich angenommen werden kann.
PW: Zunächst einmal bedeutet „BRAKE“ für uns eben nicht „brechen“, vielmehr ist es für uns die „Bremse“ von Radikalisierungsprozessen. Es ist natürlich ein Akronym, das sich als Bild angeboten hat. „BRAKE“ beinhaltet alles, was unseren Ansatz ausmacht: Wichtig ist das „B“, das steht für beziehungsgestützt. Wir gehen in diesen Trainings mit den Beteiligten eine Beziehung ein, um überhaupt eine nachhaltige Interventionsberechtigung zu erlangen. Das „R“ steht für Reflexionsarbeit, die wir in den Trainings mit den Klient*innen umsetzen: Die Jugendlichen sollen durchaus ihre Biografie, ihre Taten und Einstellungen reflektieren bzw. diese werden gemeinsam reflektiert. Das „A“ steht für aufsuchend. Einer der wichtigsten Aspekte von Beziehungsarbeit ist schließlich auf dieser Grundlage entsprechend kritisch zu sein und dass diese Kritik („K“) über eine bestehende Beziehung vom Gegenüber auch wirklich angenommen werden kann.
All das soll einen Entwicklungsprozess („E“) in Gang setzen. Abwertenden Weltbildern wird nicht selten erstmals eine humanistisch geprägte Haltung entgegengesetzt. Das führt oft zu einem „Aha-Effekt“, weil die Jugendlichen diesen konstruktiven und klaren Widerspruch im respektvollen Gespräch nicht gewohnt sind oder derlei andere Haltungen eben noch gar nicht erfahren haben. Dadurch entsteht auch so etwas wie eine verhandelbare, je nach Inhalt und Situation, auch eine nicht verhandelbare Grenzsetzung den Jugendlichen – auch in Schulkontexten oder Regelstrukturen, weil selbst seitens des Bezugssystems Angst vor einer solchen (politischen) Auseinandersetzung besteht. Eine wie auch immer geartete Grenzsetzung gibt Menschen eine Orientierung nach der heute, in dieser globalen, unübersichtlichen Welt, alle suchen. Wenn wir es dann schaffen, unsere menschenrechtsorientierten Grenzen dem Gegenüber nachvollziehbar zu vermitteln, sind wir schon einen ganz großen Schritt im Training weiter.
Selbstbewusst im Umgang mit rechtsextrem einstiegsgefährdeten Jugendlichen: Hilfe zur Selbsthilfe für Pädagog*innen
RUK: Der Druck auf die Bezugssysteme von Jugendlichen, die Schulen, Ausbildungsstätten, aber auch Freizeitangebote ist in jedem Falle groß. Die
Anforderungen an Pädagoginnen und Pädagogen sind dabei in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen – unter gleichzeitiger Kürzung finanzieller Mittel. Antidemokratische Orientierungen junger Menschen und insbesondere die Einflussnahme der extremen Rechten, sind hier nur eine zusätzliche Herausforderung. Braucht es mehr Entlastung in der Jugendarbeit oder vielleicht auch Bereitschaft zu mehr Verantwortung? Welchen Beitrag können spezialisierte Akteure wie Distanz e.V. hier leisten?
PW: Speziell die Distanzierungsarbeit, sowie der Umgang mit Phänomenen der extremen Rechten überfordert die Regelstruktur nicht selten. Für uns ist das auch nachvollziehbar. Wenn es hier zur Sache geht, dann braucht es Fachmenschen. Deshalb gibt es Spezialinstitutionen wie uns, die Ausstiegsarbeit, oder die mobile Beratung. Die Regelstrukturen haben natürlich auch noch andere Aufträge mit den Multi-Problemlagen bei Jugendlichen oder einfach auch die konstruktive Begleitung junger Menschen in das demokratische Leben in unseren Gesellschaften. Das mussten wir auch erst Mal lernen.
Trotzdem spricht das gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Situation die Regelstrukturen und Pädagog*innen generell nicht frei davon, sich zu den überall sichtbaren, gesellschaftlichen Herausforderungen fortzubilden. Denn sie arbeiten mit den jungen Menschen und sollten erkennen oder zumindest erfragen, um sich dann bestenfalls über die ihnen bekannten Verweisstrukturen Hilfe zu holen. Das Wichtige für Pädagog*innen, nicht zuletzt für das eigene Sicherheitsgefühl, ist, dass jede*r Erstinterventionen durchführen kann. Deshalb haben wir auch das Zentrum für Distanzierungsarbeit und den Beratungs- und Fortbildungsauftrag für pädagogische Fachkräfte vom Land Thüringen eingerichtet. Dort geht es darum, die Kompetenzen und das Selbstbewusstsein für Distanzierungsarbeit und die Anwendung von Interventionstechniken zu vermitteln – an Pädagog*innen und für alle Menschen, die mit rechtsextrem einstiegsgefährdeten und -orientierten Jugendlichen zu tun haben.

Denn es kommt immer öfter vor, dass „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ (GMK) geäußert oder wieder häufiger der Hitlergruß einfach mal „nur aus Spaß“ gezeigt wird. Die Frage ist dann, wie ich in der Beziehung zu Jugendlichen richtig auf diese angeblichen „Späße“ reagiere. Denn – so viel darf ich verraten – konstruktive Vorgehensweisen sind hier vielfältig und jede Situation muss für sich eingeschätzt werden, obwohl wir es hier eindeutig mit einer Straftat zu tun haben.[iv]
Deshalb ist es für Pädagog*innen wichtig zu wissen: Wie gehe ich damit um? Wie mache ich meine immer häufig nachgefragtere Erstintervention? Genau dafür bieten wir Fortbildungsmodule an. Generell ist der Auftrag und Wunsch von Fördermittelgebern wie „Demokratie leben!“ oder auch des Landesprogrammes „DenkBunt“, dass Präventionsarbeit als eine Querschnittsaufgabe in die Regelstrukturen eingebracht wird. Denn genau dann kann eine sinnvolle Verankerung in langlebigen Strukturen gelingen und eben nicht die Verlagerung dieser Herausforderungen in die gefürchtete „Projektitis“: Das bedeutet, eben nur zeitlich begrenzt zu einer gesellschaftlichen Herausforderung zu arbeiten. Wenn wir dann die von mir dargelegten Kriterien für eine gelingende Distanzierungsarbeit – zum Beispiel die der Beziehungsarbeit – betrachten, ist diese natürlich nur langfristig sinnvoll, weil es sonst zu einem Beziehungsabbruch oder irgendwann gar nicht mehr zu einer Beziehungsaufnahme führt. Das gilt im Übrigen für Klient*innen genauso wie für Pädagog*innen, Institutionen und Gemeinwesen.
 Wir bringen diesen Aspekt unserer Interventionsarbeit also verstärkt in die Regelstrukturen ein, um die Selbstsicherheit von Pädagog*innen zu stärken und nachhaltig Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln: Wie gehe ich mit meiner eigenen Angst um, wenn ich mit Phänomenen der extremen Rechten konfrontiert werde? Wie kann ich dann gut intervenieren? Unsicherheiten sollen gewendet werden in: Ich weiß, wie ich das fachlich richtig verweise und wie ich selbst weiter damit umgehe. Jede*r kann bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben und uns die Situation erläutern. Und dann beraten, coachen, bilden wir fort oder übernehmen die Jugendlichen selbst in unsere Trainings.
Wir bringen diesen Aspekt unserer Interventionsarbeit also verstärkt in die Regelstrukturen ein, um die Selbstsicherheit von Pädagog*innen zu stärken und nachhaltig Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln: Wie gehe ich mit meiner eigenen Angst um, wenn ich mit Phänomenen der extremen Rechten konfrontiert werde? Wie kann ich dann gut intervenieren? Unsicherheiten sollen gewendet werden in: Ich weiß, wie ich das fachlich richtig verweise und wie ich selbst weiter damit umgehe. Jede*r kann bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben und uns die Situation erläutern. Und dann beraten, coachen, bilden wir fort oder übernehmen die Jugendlichen selbst in unsere Trainings.
Mit der Beratung und Fort- und Weitbildung der Fachkräfte können wir bewirken, dass Multiplikator*innen schon frühzeitig von transparenten und konstruktiven Grenzsetzungen Gebrauch machen. Und in unseren Trainings können wir einzelne Jugendliche für unsere demokratische menschenrechtsorientierte Gesellschaft zurückholen. Für Jugendliche aus unserer Zielgruppe ist die Abwertung anderer eine Möglichkeit, das eigene Selbstbewusstsein aufzuwerten. Mit unserer Arbeit können wir hier sinnstiftend eine echte, menschenrechtsorientierte Alternative bieten.
Weiterführende Literatur:
Grimm, Rebekka/Meixner, Judith/Müller, Lisa/Pannemann, Malte/Wiechmann, Peer (2024). Den Einstieg in den Rechtsextremismus verhindern. Aufsuchende Distanzierungsarbeit gegen Radikalisierung bei jungen Menschen. Ein Leitfaden. Barbara Budrich, Leverkusen-Opladen und Berlin.
Verweise im Text:
[i] Bspw. Stöss, Richard (2010). Rechtsextremismus im Wandel, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, inbes. Kap. 7 „Protestverhalten, Subkulturen und Gewalt“, 147-167, in: https://library.fes.de/pdf-files/do/08223.pdf (letzter Zugriff am 19.Juni 2025).
[ii] Deutscher Präventionstag, „Größter Rechtsruck unter Jugendlichen und Jungwähler*innen seit 1949“, 03.September 2024, in: https://www.praeventionstag.de/nano.cms/news/details/9310 (letzter Zugriff am 19.Juni 2025).
[iii] Götschenberg, Michael (2025). Razzia gegen mutmaßliche rechte Terrorzelle, 21.Mai 2025, tagesschau.de, in: https://www.tagesschau.de/inland/razzia-terrorgruppe-100.html; Rechtsextremisten in NRW: Immer jünger und über Social Media vernetzt, WDR, 21.Mai 2025, in: https://www1.wdr.de/nachrichten/rechtsextremisten-in-nrw-100.html (jew. letzter Zugriff am 19.Juni 2025).
[iv] Der Verweis auf eine potenzielle Straftat gilt hier dem „Kennzeichenverbot des § 86a StGB, der das „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ unter Strafe stellt: „Danach ist es strafbar, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zu verbreiten oder öffentlich, in einer Versammlung oder in verbreiteten Inhalten zu verwenden. […] Der Norm wird eine herausragende Bedeutung zugeschrieben: [Insbesondere da] sich die rechtsextreme Szene in zunehmendem Maße nationalsozialistischer Symbole bediene, um für ihre Zwecke zu werben. 3 Neben bestimmten rechts- und linksextremen Gruppen fallen verschiedene islamistische Vereinigungen und linksextreme Ausländervereine, sowie – seit einer Gesetzesänderung im September 20215 – auch terroristische Organisationen im Sinne des EU-Rechts mit ihren Symbolen in den Anwendungsbereich des strafrechtlichen Kennzeichenverbots,“ in: Trips-Hebert, Roman (2021). Das strafbare Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen § 86a StGB im Spiegel der Rechtsprechung, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Infobrief WD 7 – 3010 – 105/2, S.4, in: https://www.bundestag.de/resource/blob/869290/c8bd5f14ef172eb76e41484886611030/Das-strafbare-Verw-von-Kennzeichen-data.pdf (letzter Zugriff am 19.Juni 2025).
Verwendete Literatur Info-Boxen
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ (2017): Politische Bildung junger Menschen. Ein zentraler Auftrag für die Jugendarbeit, in: www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2017/Politische_Bildung_junger_Menschen.pdf. (letzter Zugriff am 19. Juni 2025)www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2017/Politische_Bildung_junger_Menschen.pdf. (letzter Zugriff am 19. Juni 2025)
Müller, Matthias/ Bräutigam, Barbara (Hrsg.) (2024). Aufsuchende Soziale Arbeit. Grundlagen, Praxisfelder und Fallbeispiele, Kohlhammer Verlag, Stuttgart.
Pfahl-Traughber, Armin (2008). Extremismus und Terrorismus. Eine Definition aus politikwissenschaftlicher Sicht, S.9-33, in: Pfahl-Traughber, Armin (Hg.), Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung 2008, Statistisches Bundesamt, Bonn.
isclaimer: Inhaltliche und politische Positionierungen und Äußerungen unserer Autor*innen und Interviewpartner*innen geben die Meinung der Autor*innen und Interviewpartner*innen wieder und entsprechen nicht notwendigerweise denen der RUK-Redaktion.
Herausgeberschaft, Redaktionelle Betreuung und Endredaktion: Miriam Müller-Rensch